Die
Methode des "DNA-Fingerprinting" gewinnt im Strafverfahren immer mehr
an Bedeutung. Außerhalb des Strafverfahrens wird die Methode der DNA-Analyse
vor allem in Vaterschaftsprozessen angewendet. Mit dieser Methode kann
der Nachweis der Vaterschaft bzw. ein Ausschluß von der Vaterschaft von
allen Beteiligten anschaulich nachvollzogen werden.
In Strafverfahren stellen Sexualdelikte das Hauptanwendungsgebiet von
DNA-Analysen dar. Voraussetzung für die Klärung von Sexualdelikten mittels
DNA-Analyse ist eine sofortige fachgerechte Sicherung des Beweismaterials
im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung des Opfers.
Da DNA-Analysen jedoch nicht nur aus Spermaspuren, sondern auch aus Blut-
und Speichelspuren, aus Haaren, Weichteilgeweben, Knochen und Zähnen durchgeführt
werden können, wird die moderne Methode des DNA-Profiling in der Rechtspflege
vermehrt und nicht nur beschränkt auf Sexualdelikte eingesetzt.
Das DNA-Profil eines Menschen ist analog seinem Fingerdruck einmalig,
weshalb das Verfahren auch als "DNA-Fingerprinting" bezeichnet wird. Um
die Bedeutung des DNA-Fingerprinting im Strafverfahren darzulegen, ist
zu allererst der Aufbau und der Ablauf des Beweisverfahrens im Strafprozeß
kurz zu erläutern.
Im Strafprozeß soll geklärt werden, ob jemand, der einer strafbaren Handlung
verdächtigt wird, diese Tat wirklich begangen hat. Falls dies zutrifft,
sollen über ihn die Sanktionen verhängt werden, die das Gesetz für die
Tat vorsieht. Das geschieht im sogenannten "Erkenntnisverfahren". Es wird
mit dem rechtskräftigen Erkenntnis, also mit dem Strafurteil abgeschlossen.
Ziel des Strafverfahrens ist daher, ein Urteil zu fällen, das der Wahrheit
entspricht. Der Schuldige soll bestraft werden.
Die Beweismittel sind die Erkenntnismittel, die dem Richter bei der Wahrheitsfindung zur Verfügung stehen, um feststellen zu können, was der Wahrheit entspricht und ob der Verdächtige auch tatsächlich schuldig ist. Die Strafprozeßordnung kennt fünf Arten von Beweismitteln: den Zeugen, den Sachverständigen, den Beschuldigten, den Urkundenbeweis und den Augenschein. Da die Beweismittel in der StPO nicht erschöpfend aufgezählt sind, muß daher grundsätzlich alles als Beweismittel gelten, was geeignet ist, die Wahrheit zu ermitteln.
Über
die Frage, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist, entscheidet der
Richter nicht nach gesetzlichen Beweisregeln, sondern nur nach seiner
freien Überzeugung, die eraus der gewissenhaften Prüfung der für und wider
vorgebrachten Beweismittel gewonnenen hat. Dies bedeutet, daß ihm nicht
vom Gesetz vorgeschrieben wird, ob er etwa einer Zeugenaussage oder einem
Sachverständigengutachten folgen soll. Eine Tatsache gilt als erwiesen,
wenn der Richter nach gewissenhafter Prüfung aller Beweise von ihrem Vorliegen
persönlich voll überzeugt ist.
Bei den Beweisen ist von ihm zu unterscheiden zwischen dem direkten Beweis
und dem indirekten oder den sogenannten Indizienbeweis.
Beim indirekten, also beim Indizienbeweis, wird nicht über die Tat selbst,
wie beim direkten, sondern über "verdachtserregende Umstände" Beweis erhoben,
wie z.B. Fingerabdrücke am Tatort oder eben biologische Spuren, die dann
einem Spurenverursacher zugeordnet werden. Damit ist jedoch noch nicht
erwiesen, daß der Spurenverursacher die Tat auch begangen hat, es kann
lediglich der Schluß daraus gezogen werden.
Welche Rolle spielt nun hierbei das DNA-Fingerprinting? Die DNA-Analyse
kommt bereits im Vorfeld des Strafverfahrens bei der Ausforschung des
Täters zum Tragen. Die Sicherheitsbehörden sind nach dem Sicherheitspolizeigesetz
ermächtigt, Menschen, die einen gefährlichen Angriff begangen haben oder
die im Verdacht stehen, erkennungsdienstlich zu behandeln. Neben der Feststellung
der Personalien, der Fotographie und der Anfertigung von Fingerabdrücken,
können auch Mundhöhlenabstriche entnommen werden. Die DNA-Merkmale von
Tatverdächtigen und die DNA-Merkmale von Tatortspuren werden untersucht
und verglichen. Das Ergebnis wird der Exekutive als Hinweis auf die Spurenverursachung
mitgeteilt, und übergibt diese nach Abschluß der Ermittlungen das DNA-Ergebnis
mit der Ermittlungsakte dem zuständigen Gericht. Im Gutachten soll der
Sachverständige, also zum Beispiel der Gerichtsmediziner im Auftrag des
Gerichtes Schlußfolgerungen ziehen, wie z.B. mit welcher Wahrscheinlichkeit
die mit der Spur in Zusammenhang gebrachte Person als Spurenverursacher
ein- oder auszuschließen ist etc. Wichtig ist, daß der Sachverständige
nur wissenschaftliche Schlußfolgerungen zu ziehen hat, und die Entscheidung,
ob der Verdächtige die Tat auch tatsächlich begangen hat, lediglich vom
Richter getroffen werden darf. Da derartige Gutachtenserstellungen ein
hohes wissenschaftliches Wissen erfordern, welches dem Richter in der
Regel fehlt, ist die Überprüfungsmöglichkeit eines SV-Gutachtens durch
den Richter natürlich in der Praxis sehr beschränkt. Das bedeutet, daß
sich der Richter bzgl. der wissenschaftlichen Richtigkeit des Gutachtens
wohl auf die Person des Sachverständigen verlassen und sich seine Kontrolle
hauptsächlich auf die Zuverlässigkeit des Gutachters sowie die Schlüssigkeit
und Nachvollziehbarkeit des Gutachtens beschränken muß. In der Praxis
ist der Richter meistens mit unterschiedlichen und einander widersprechenden
Aussagen konfrontiert, sodaß sich die Frage stellt, wie der Richter nun
zur "Wahrheit" gelangt. Gesetzt den Fall, daß jemandem vorgeworfen wird,
er habe einen Mord begangen, und der Verdächtige bestreitet jedoch die
Tat: Ein Zeuge sagt aus, daß der Verdächtige zum Tatzeitpunkt bei ihm
gewesen sei, sodaß er unmöglich der Täter sein könne. Da das Opfer keine
Aussage mehr machen kann, wird der Richter einem Sachverständigen den
Auftrag erteilen, auf Grund der sichergestellten Spuren ein Gutachten
zu erstellen. Das DNA-Profiling stellt hiebei eine der sichersten Methoden
dar, um eine zu Unrecht angeschuldigte Person als Spurenverursacher zu
entlasten. Umgekehrt erlaubt die hohe genetische Vielfalt der DNA-Merkmale
die Zuordnung einer Spur zu einem Tatverdächtigen mit praktischer Gewißheit.
Es besteht jedoch die Gefahr, daß die Spur von jemand anderem absichtlich
manipuliert sein kann. Es ist daher nochmals zu betonen, daß es sich bei
dieser Art von Beweis immer nur um einen Indizienbeweis handeln kann.
Kommt der Sachverständige in seinem Gutachten nunmehr zum Ergebnis, daß
das Bandenmuster der tatverdächtigen Person mit der Spur übereinstimmt,
so muß der Richter nun entscheiden, ob er dem Gutachten folgt und daher
zur Ansicht gelangt, daß der Verdächtige die Tat begangen hat, oder ob
er den Aussagen des Verdächtigten und des Zeugen folgt, und den Verdächtigen
vom Vorwurf freispricht. Der Richter ist in seiner Entscheidung frei,
ob er die Aussagen des Beschuldigten und des Zeugen für glaubwürdig und
richtig hält, oder ob er dem Gutachten folgt. Er muß in seinem Urteil
nur angeben, aus welchen Gründen er zu seiner Entscheidung gelangt ist.
Die Entscheidung des Richters muß schlüssig und nachvollziehbar sein.
In der Praxis kommt jedoch dem Sachverständigengutachten sehr hohe Bedeutung
zu.
Diese neue und revolutionierende Methode des DNA-Fingerprinting bringt
natürlich auch sehr viele Gefahren mit sich. Wie bereits erwähnt, ist
es eine Leichtigkeit, z.B. ein Haar oder Speichelspuren auf Zigarettenkippe
an einem Tatort zu plazieren und somit die Spur auf eine Person zu lenken,
die möglicherweise sich zum Tatzeitpunkt gar nicht am Tatort befunden
hat. Da in der Praxis in Strafverfahren vielfach aufgrund von Sachverständigengutachten
entschieden wird, besteht die Gefahr, daß Unschuldige verurteilt werden.
Denn aufgrund des Gutachtens kann nicht direkt abgeleitet werden, daß
der Verdächtige die Tat auch tatsächlich begangen hat. Derartige Manipulationsmöglichkeiten
waren natürlich auch schon bisher möglich, da man z.B. am Tatort einen
Gegenstand mit Fingerabdrücken einer bestimmten Person hinterlassen kann.
Auf Grund der neuen DNA-Analyse, die bereits auf Grund kleinster Speichelspuren,
Haare oder Weichteilgewebe durchgeführt werden kann, ist die Manipulationsmöglichkeit
natürlich um ein Vielfaches höher. Inwieweit eine solche Manipulationsmöglichkeit
im konkreten Fall gegeben war, wird wohl auch der Sachverständige zu prüfen
haben. Wie können nun solche Daten verwaltet werden? Um den Einsatz der
neuen Technik effizient durchführen zu können, gibt es seit einiger Zeit
mehrere nationale kriminalistische DNA-Datenbanken. In Europa gibt es
derzeit in Großbritannien, den Niederlanden und nun in Österreich eine
entsprechende Einrichtung. Das Institut für gerichtliche Medizin der Universität
Innsbruck ist das "Österreichische DNA-Zentrallabor" für die Untersuchung
der Mundhöhlenabstriche und biologischen Spuren. Als zweite Untersuchungsstelle
wird zur Zeit das Institut für Gerichtsmedizin in Salzburg hierfür vorbereitet.
Dazu werden von der Exekutive bei bestimmtem Tatverdacht, wie z.B. Mord
und Sexualdelikten, Mundhöhlenabstriche entnommen und direkt an das DNA-Zentrallabor
gesandt. In gleicher Weise werden biologische Tatortspuren von Kriminalfällen
untersucht, in denen keine Person im konkreten Tatverdacht steht und werden
die Labordaten vom DNA-Zentrallabor dem Bundesministerium für Inneres
übermittelt. Dort werden die DNA-Daten mit den Personaldaten des erkennungsdienstlich
Behandelten zusammengeführt und die Ergebnisse der Mundhöhlenabstriche
und der Spuren auf Übereinstimmung überprüft. Die erkennungsdienstlichen
Daten einschließlich der DNA-Merkmale werden, wie schon bisher, beim Bundesministerium
für Inneres gespeichert. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich
auch die Frage, wie lange derartige erkennungsdienstliche Daten gespeichert
werden, und welche Möglichkeiten der Betroffene hat, um diese Daten wieder
zu löschen. Die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen befinden sich
im Sicherheitspolizeigesetz. Unter Erkennungsdienst versteht das Gesetz
das Ermitteln personenbezogener Daten durch entsprechende Maßnahmen sowie
das Verarbeiten, Benützen, Übermitteln, Überlassen und Löschen dieser
Daten. Bezüglich der Löschung gibt es nun grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Wenn kein Verdacht mehr besteht, daß der Betreffende rechtswidrig eine
maßgebliche Straftat begangen hat, Und wenn ein entsprechender Verdacht,
daß der Betreffende rechtswidrig eine maßgebliche Straftat begangen hat,
nicht bestätigt werden konnte, so kann der Betroffene einen Antrag zur
Löschung einreichen. Jedenfalls nicht in Frage kommt eine Löschung dann,
wenn feststeht, daß die betreffende Person objektiv rechtswidrig eine
maßgebliche Straftat begangen hat. Weiters ist die Behörde nicht zur Löschung
verpflichtet, wenn auf Grund konkreter Umstände zu befürchten ist, daß
der Betroffene gefährliche Angriffe begehen werde. Das bedeutet, daß z.B.
im Falle eines Freispruches im Zweifel - wenn also die Beweise für eine
Verurteilung nicht genügten - die Daten unter Umständen weiter gespeichert
bleiben.





Die Spannung erreicht den fast unerträglichen Höhepunkt: "Haben wir ein positives Ergebnis?"


Schweinerei, diese viele Arbeit!
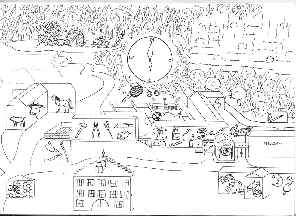
Erster Entwurf für die Einstiegsseite auf der CD-ROM.

Kameramann sichern! Aufnahme in 5 Sekunden! 5, 4, 3, 2, 1 action!

Unsere beiden Digital-Filmkameras positionierten wir immer möglichst unterschiedlich, um mehrere spannende Perspektiven der Szene für den nachfolgenden Filmschnitt zu bekommen.


Auch wenn das Laborgeschick der Schüler beeindruckend war, mußte doch dann und wann beratend und kontrollierend zur Seite gestanden werden.